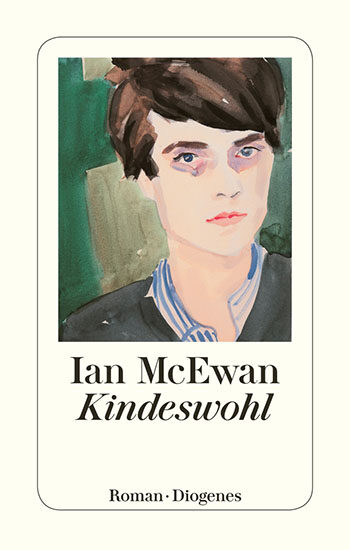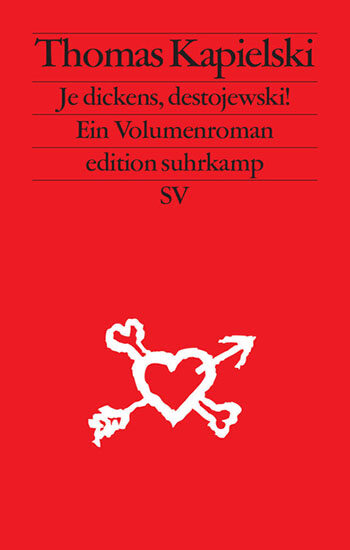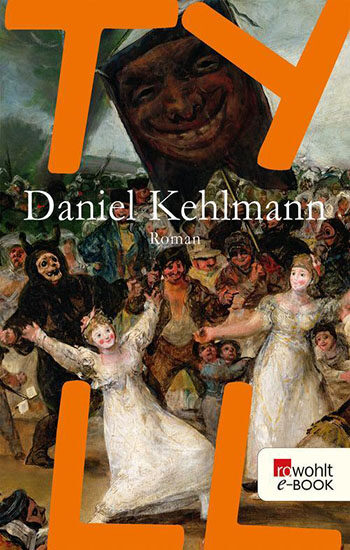von Haruki Murakami
Erste Person Singular
Ich möchte hier von einer jungen Frau erzählen. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich so gut wie nichts über sie weiß. Nicht einmal an ihren Namen und ihr Gesicht kann ich mich erinnern.Da ist er wieder, der geheime Meister des melancholischen fiktiven Realismus. Die einen langweilt er mit seiner unaufgeregten Erzählweise zu Tode, die anderen hätten ihm am liebsten schon vor Jahren den Nobelpreis für Literatur verliehen. Welchem Lager man sich auch immer selbst anschließen möchte: Unbestritten ist jedenfalls, dass Murakami einen ganz eigenen Erzählstil hat und sich nicht zuletzt durch seine Fähigkeit, auch ganz banalen Alltäglichkeiten einen leisen Zauber einzuhauchen, einen festen Platz im Kanon anspruchsvoller Gegenwartsliteratur verdient hat. Mit Romanen wie ‹Mister Aufziehvogel› oder ‹Kafka am Strand› hat er seine Erzählkunst bravourös unter Beweis gestellt.
Manche behaupten, die glücklichste Zeit im Leben eines Menschen seien die Jahre, in denen Popsongs sich ganz natürlich und unauslöschlich ins Gedächtnis einbrennen. Vielleicht stimmt das. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist ein Popsong ja doch nur ein Popsong und unser Leben letztendlich nicht mehr als ein hübscher Wegwerfartikel oder ein farbenfroher Blütenschauer.Auch ‹Erste Person Singular› ist auf den ersten Blick wieder ein typischer Murakami: In den insgesamt acht Erzählungen geht es wie so oft um Themen wie Musik, Schönheit und die Frage danach, wie und wodurch man zu dem wird, der man ist. Im Mittelpunkt der Erzählung ‹Carnaval› etwa steht der gleichnamige Klavierzyklus von Georg Schumann, der die Basis für eine ungewöhnliche Bekanntschaft bildet. Aufhänger für ‹Charlie Parker plays Bossa Nova› ist ein scherzhafter Artikel über eine fiktive Platte des großen Jazz-Musikers, die den Ich-Erzähler Jahre später auf wundersame Weise wieder in seine Jugendzeit zurückholt. Und in ‹Bekenntnisse des Affen von Shinagawa› spielt ein sprechender und Bier trinkender Affe die Hauptrolle mit der skurrilen Fähigkeit, den Frauen, die er liebt, durch Willenskraft den Namen zu stehlen.
Das epochemachende Ereignis des folgenden Jahres 1965 waren für mich weder die Bombardierung Nordvietnams auf Befehl Präsident Johnson noch die darauffolgende Eskalation des Vietnamkriegs noch die Entdeckung der endemischen Iriomote-Wildkatze, sondern der Umstand, dass ich eine Freundin hatte.Wie so oft bei Murakami steht auch in ‹Erste Person Singular› nie eine wirkliche Handlung im Vordergrund; die Erzählungen fließen vielmehr ruhig und seicht vor sich hin. Und wie ebenfalls so oft kann man den Autor Murakami nicht immer eindeutig von seinem Ich-Erzähler trennen, da er an vielen Stellen Fiktion und autobiographische Einflüsse miteinander verwebt.
Ehrlich gesagt fühlte es sich ein wenig seltsam an, neben einem Affen zu sitzen und Bier zu trinken, aber wahrscheinlich war es nur eine Frage der Gewöhnung.Nach etwas mehr als 200 Seiten bleibt man ratlos zurück. Einige der Erzählungen sind dermaßen egal, dass man sich zuletzt schon gar nicht mehr an sie erinnert. Insgesamt kommt ‹Erste Person Singular› bei Weitem nicht an frühere Werke Murakamis heran. Selbst der flüssige Erzählstil und die immer wieder gezielt eingestreuten lakonisch-selbstkritischen Einwürfe können nicht darüber hinwegtrösten, dass die Erzählungen leider mehr Tiefen als Höhen aufweisen. So mancher eingefleischter Murakami-Fan mag mit diesen Texten dennoch seine (kurze) Freude haben - ansonsten hat ‹Erste Person Singular› aber leider kaum etwas zu bieten.

Erste Person Singular
von Haruki Murakami
224 Seiten, € 22,00, gebunden
DUMONT, ISBN 978-3832181574
aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
→ Leseprobe→ kaufen
DUMONT, ISBN 978-3832181574
aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
→ Leseprobe→ kaufen
Rezensiert von Alexander Schau

Alex lebt schon eine Weile nicht mehr in Leipzig, liebt aber immer noch Ebooks und liest eigenen Angaben zufolge durchschnittlich 6,73 Bücher pro Monat. Paulo Coelho findet er immer noch widerlich, daran hat auch der Umzug nichts geändert.