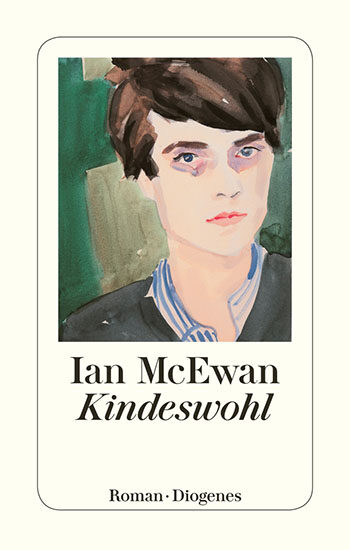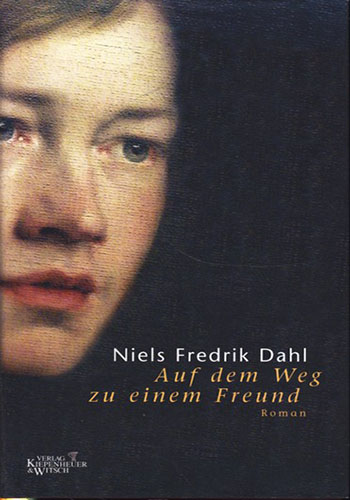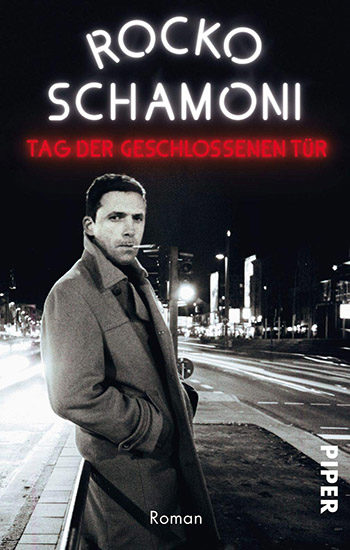von Philipp Winkler
Carnival
Der Nebel hat das Meer verschluckt. Wie eine Wand steht er dort, wo der Strand beginnt. An den Anblick des Wassers kann ich mich nicht gewöhnen. Immer suche ich nach einem ge- genüberliegenden Ufer, das mir Halt geben könnte, aber bis auf Meer und Himmel ist da nichts. An diesigen Tagen ver- schwimmt selbst diese Grenze.Das Riesenrad dreht sich nicht mehr, die Buden sind weg. Wo früher eine Kirmes stand, sind nun Parkplätze, Einkaufszentren und Industriegebiete.
So beginnt sie, die Klage des namenlosen Schaustellers in »Carnival«.
Zu verorten ist der Erzähler vermutlich in den USA. Seine Hauptaufgabe scheint vor allem zu sein, das schillernde, eigenbrötlerische fahrende Volk vorzustellen, das Personal des »Carnival«. Als ginge er von Bude zu Bude, reiht er die verschiedensten Persönlichkeiten an den Spiel- oder Fressbuden, dem Schaukampf und der Freak Show auf, erzählt davon, wie sie auf dem Jahrmarkt geboren wurden und aufwuchsen oder wie sie zufällig ihren Weg zu den Kirmsern fanden und blieben – ein zwar zusammengewürfelter, aber in sich geschlossener Verbund.
Ihnen, den Schaustellern, sind die Jahrmarktsbesucher entgegengestellt, jene, die nur zum Vergnügen auf die Kirmes kommen, um sich vollzufressen, sich zu betrinken und um Spaß zu haben. Verächtlich schauen die Schausteller auf ihre Kundschaft, auf deren Geld sie angewiesen sind und für die sie eine ganze Reihe abschätziger Spitznamen haben, die Steifen Jonnys mit ihren Bälgern, die Marks, die Örtler. Über die 119 Seiten des Romans erstreckt sich diese Gegenüberstellung des Ihr und Wir und aus dem Ton des Erzählers dringt tiefe Verachtung für die Örtler, die früher ihren Spaß auf der Kirmes haben wollten, die aber irgendwann die Lust daran verloren, weil sie dank Fernsehen und Internet nun nicht mehr aus dem Haus zu gehen brauchen, um sich zu amüsieren.
Mit seinem Debüt »Hool« ist Philipp Winkler dafür bekannt geworden, einer sonst in der Literatur selten vorkommenden gesellschaftlichen Gruppe, den Hooligans, eine Stimme gegeben zu haben. Mit »Carnival«, so scheint es, unternimmt er den nächsten Versuch, einer Personengruppe eine Stimme zu geben, die sonst selten portraitiert wird. Doch leider mag dieses Mal das nicht wirklich gelingen. Abgesehen davon, dass die Kirmes, die der Ich-Erzähler in nostalgisch-verbitterten Farben malt, völlig aus der Zeit gefallen zu sein scheint (Freak Shows / Sideshows, Ringkämpfe) und eher wie eine Kreuzung aus Jahrmarkt und Zirkus wirkt (Messerwerfer, Schwertschlucker), bleibt die Front zwischen dem Ihr und dem Wir zu plakativ, der abschätzige Blick und die Anklage an das wegbleibende Publikum zu pauschal, zu verbittert und zu eindimensional.
Vor dem Hintergrund der lebendigen Volksfestkultur in Deutschland wirkt »Carnival« wie ein Kampfschauplatz, den es hier überhaupt nicht gibt. Stattdessen ist es von trauriger Ironie, dass gerade jetzt, wenn dieses Buch erscheint, Schausteller reihenweise um ihre Existenz fürchten – aber mitnichten aufgrund der Unlust des Publikums, sondern weil die Corona-Pandemie ihnen einen Strich durch sämtliche Planungen gemacht hat. Corona hat dazu geführt, dass zahllose Schaustellerinnen und Schausteller seit den Weihnachtsmärkten im vergangenen Jahr keinerlei Umsatz mehr gemacht haben. Keine Frühlingsjahrmärkte, keine Volksfeste, kein Herbstjahrmarkt. Die Volksfestkultur in Deutschland ist nicht wegen der Unlust der Besucher zum Erliegen gekommen. Das Problem, die wegbleibende Kundschaft, mag das gleiche sein, aber der Auslöser ist ein völlig anderer.
Bleibt zu hoffen, dass Corona die Volksfeste nicht ganz auf dem Gewissen haben wird. Denn die Örtler wären da.

Carnival
von Philipp Winkler
Rezensiert von Rike Zierau
Rike liest nur halb so viel, wie sie es gern möchte und mag weniger als die Hälfte der Bücher nur halb so gern, wie sie es (vielleicht) verdienen. Iris Radisch hält sie für eines der besten Dinge, die der Literaturwelt passieren konnten.